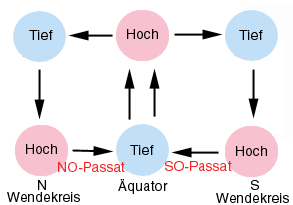
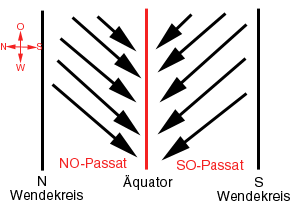
Windsysteme und regionale Winde
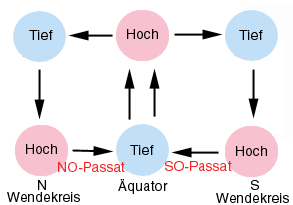 |
Abbildung 1 : Durch die intensive Sonneneinstrahlung am Äquator steigen die Luftmassen dort auf und erzeugen in der Höhe ein Hochdruckgebiet und am Boden ein Tiefdruckgebiet. Der Sog dieses Tiefs reicht bis zu den Wendekreisen. Die dabei entstehenden Winde werden Passate genannt. |
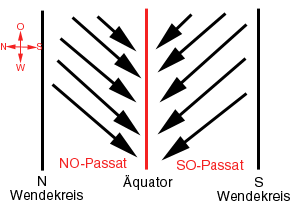 |
Abbildung 2 : Die Ablenkung durch die Corioliskraft lenkt die Winde soweit ab, dass sie stets aus östlicher Richtung wehen. Die sogenannten Süd-Ost und Nord-Ost Passate. |
Da die Sonne ihre Position über der Erde stetig verändert wandert der Ort der intensivsten Sonneneinstrahlung im Laufe eines Jahres von Süd nach Nord und zurück. Dadurch verschiebt sich der Ort an welchem der NO-Passat und der SO-Passat zusammen fließen. Diese sich stetig verändernde Linie oder Zone des Aufeinandertreffens der Passate wird als ITC bezeichnet : Innertropische Konvergenz. Diese Linie wird im Gegensatz zum mathematischen Äquator bei 0°, meterologischer Äquator benannt und variert ungefähr zwischen dem Äquator und 10° N.
Lokale und regionale Winde
Neben dem unter dem Kapitel Luftdruck beschriebenen planetarischen Windsystem existieren eine Reihe kleinerer, örtlich begrenzter Windsysteme. Sie werden in drei Gruppen unterteilt:
1. Tagesperiodische Winde mit Richtungsumkehr
Land- Seewindzirkulation
Wasser und Land reagieren unterschiedlich auf die Sonnenstrahlung. Während die Wasseroberfläche den größten Teil der Strahlung reflektiert und sich nur langsam erwärmt, setzt die Landoberfläche die eintreffende kurzwellige Strahlung in langwellige Strahlung um und erwärmt sich rasch. Die Temperaturamplitude (-veränderung) liegt beim Meer nur in etwa bei 0,5°C. Beim Land kann die Temperaturamplitude sogar 15°C betragen. Die Seewinde dringen in Europa bis zu 50km auf den Kontinent vor, in den Tropen sogar bis zu 200km.
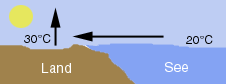 |
Abbildung 3: Die Erwärmung der Landoberfläche läßt die Luft aufsteigen und führt zu Tiefdruck in Bodennähe. Die Luftmassen des kühleren Meeres strömen Richtung Land. |
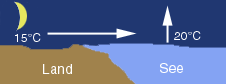 |
Abbildung 4 : Das Wasser als hervorragender Wasserspeicher hat seine Temperatur weitestgehend behalten und ist jetzt wärmer als die Landmasse. Der Wind dreht um. |
Berg- und Talwind
In den Gebirgen entwickeln sich ähnliche Zirkulationen wie am Meer. Allerdings lassen sich zwei unterschiedliche Zirkulationen unterscheiden : die Hangwindzirkulation und die eigentliche Berg- Talwindzirkulation die parallel zu Längsachse des Tales von oberem zum unterem Ende verläuft. Hangaufwärtsgerichtete Winde werden als anabatische Winde und talabwärts als katabatische Winde bezeichnet.
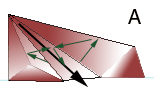 |
Abbildung 5a: Lage nach Sonnenaufgang : Einsetzen der Hangaufwinde (grüne Pfeile), Talabwind oder Bergwind aber noch im Gang, da die Luft im Tal noch kälter ist als in der Ebene. Ein absteigender Ast der Hangwindzirkulation speist zunächst noch den Talabwind |
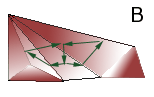 |
Abbildung 5b: Mit zunehmender Erwärmung erstirbt der Talabwind. die Hangwindzirkulation sorgt allein für Windbewegung. |
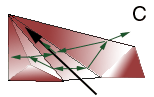 |
Abbildung 5c : Gegen Mittag setzt der Talaufwind ein, der den Hangaufwind speist, aber auch Zufuhr aus der Hangwindzirkulation erhält. |
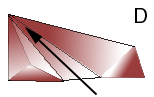 |
Abbildung 5d : Am späten Nachmittag ist allein der Talaufwind tätig. |
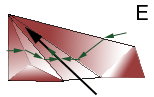 |
Abbildung 5e : Am Abend setzt der Hangabwind ein, dessen jetzt aufsteigender Ast über der Talmitte noch kurze Zeit den Talwind unterstützt |
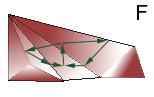 |
Abbildung 5f : Jetzt stellt sich eine gegenüber dem Vormittag umgekehrte Hangwindzirkulation ein. |
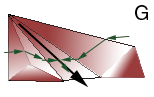 |
Abbildung 5g : Bei der Abkühlung in der Nacht setzt der Hangabwind ein der Zufluß vom Bergwind erhält |
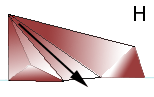 |
Abbildung 5h : Gegen Morgen erfüllt der Bergwind das Tal. Bei Sonnenaufgang weht der Wind dann wieder wie bei Abb.5a beschrieben. |
2. reliefbedingte Fallwinde oder orographische Winde
Im Gegensatz zu Tageszirkulationswinden sind Fallwinde reliefbedingt. Sie treten auf den Leeseiten höherer Gebirge oder an den Steilabfällen hochgelegener Plateaus auf und werden durch den Charakter der Luft bei Auf- wie Abstieg bestimmt.(siehe dazu auch adiabatische Abkühlung im Kapitel Wolken). Der wohl fast allen bekannte Fallwind ist der alpine Föhn, der auf der folgenden Abbildung dargestellt wird.
|
Abbildung 6: Der alpine Südföhn |
Bei einem Druckgefälle von Italien nach Mitteleuropa werden die Luftmassen nordwärts in Bewegung gesetzt und an der Alpensüdseite zum Aufstieg gezwungen. Angenommen es wären 10°C in 100m Höhe auf der Alpensüdseite mit etwa 70% relativer Luftfeuchte. Nach dem Aufsteigen kühlt sich die Luft zunächst gemäß dem trocken adiabatischen Gradienten von 1°C/100m ab. Im 700m Niveau wird bei einer Temperatur von 4°C das Kondensationsniveau erreicht. Bei weiterer Anhebung der Luft kommt es zu Wolkenbildung und Niederschlägen, dabei kühlt sich die Luft wegen der frei werdenden Kondensationswärme bis zu den Paßhöhen nur noch nach dem feucht adiabatischen Gradienten um 0,6°/100m abund erreicht so bei 2700m eine Temperatur von -8°C. Nach überschreiten der Päßhohe steigt die Luft wieder ab und erwärmt sich wieder gemäß des trocken adiabatischen Gradienten. Im Alpenvorland erreicht die Lufttemperatur somit etwa 14°C bei nur noch 30% relativer Luftfeuchte. Die Wolken lösen sich auf und der Südföhn tritt als warmer und sehr trockener Wind auf. Seine jetzt enorme Aufnahmekapazität für alle Formen der Feuchtigkeit haben ihm die Bezeichnung "Schneefresser" und "Traubenkocher" beschert. Beispiele für Föhnlagen bieten der französische Mistral (Rhonetal) und die Bora an der italienischen Adria.
3. Synoptische Regionalwinde
Synoptische Winde sind an Wetterlagen gebundene, regionaltypische Winde mit je nach Region unterschiedlichen Bezeichnungen aber ähnlichen Entstehungsmerkmalen. Sie entwickeln sich an den Vorderseiten ostwärts ziehender Tiefdruckgebiete und sind aus diesem Grund in Frühjahr und Herbst anzutreffen. Sie transportieren tropische-subtropische Luftmassen nordwärts.
Monsun
Der Monsun ist ein beständig wehender kontinentweiter Wind mit halbjährlichem Richtungswechsel, der im Sommer starke Niederschläge und im Winter sonniges, trockenes Wetter mit sich bringt. Er entsteht durch Temperaturunterschiede, die zwischen der Luft über dem Festland und den Ozeanen bestehen (Land- Seewind) in Kombination mit den planetarischen Windsystemen wie die Passate. Der Monsun beeinflusst das Klima in Indien, Bangladesh, Südostasien und teilweise auch im nördlichen Teil Australiens sowie in West- und Ostafrika.
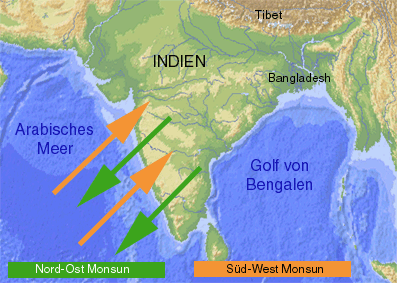 |
Abbildung 7 : Der feuchtigkeitsbeladene Süd-West Monsun kommt erst vorm Hochland von Tibet dazu seine gewaltigen Wassermassen vom warmen Arabischen Meer völlig zu entlassen. Überschwemmungen im extrem tief liegenden und übervölkerten Bangladesh sind deshalb keine Seltenheit. |
Der Indische Subkontinent kann als Beispiel für ein typisches Monsunklima angeführt
werden. Zu Beginn der Winterzeit kühlt sich der Subkontinent rapide ab, während die
Temperatur über dem Indischen Ozean relativ warm ist. Dies hängt damit zusammen, dass
sich das Festland schneller abkühlt als die Wassermassen des Ozeans. Durch das warme
Wasser wird die Luft über den Ozeanen erwärmt und steigt nach oben. Dies führt dazu,
dass am Boden kühle Luftmassen aus dem Himalaya und aus Nordindien in Richtung Indischer
Ozean nachströmen. Hierdurch entstehen die nordöstlichen Winter-Monsunwinde, die im
Winter kühles, trockenes und sonniges Wetter nach Indien bringen.
Mit Anbruch des Sommers verläuft derselbe Prozess in umgekehrter Richtung. Über
Südasien und dem Himalaya erfolgt die Erwärmung der Luft schneller als über dem
Indischen Ozean. Über dem Land nach oben steigende warmen Luftmassen werden durch große
Mengen kühler, feuchter Luft vom Meer ersetzt. Hierdurch entstehen die bodennahen
südwestlichen Winde, die den Beginn des Sommermonsuns kennzeichnen. Die von diesen Winden
transportierte Feuchtigkeit kondensiert über dem Festland und geht in starken
Niederschlägen über Indien nieder. Die monsunale Regenzeit dauert normalerweise von Juni
bis September.