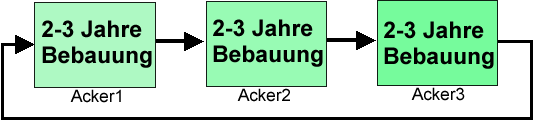
Bodennutzung und Ertragsstrukturen
Wenn ein Acker (Parzelle) Jahr für Jahr mit derselben Pflanze bestellt wird, verliert er seine Ertragsleistung. Die von der Pflanze benötigten Nährstoffe sind verbraucht. Um diesem Umstand entgegenzuwirken führten Landwirte die Urwechselwirtschaft auf ihren Böden ein. Sie wechselten die Acker alle 2-3 Jahre und ließen einen oder zwei, von drei Ackern z.B. brach, also unbebaut liegen.
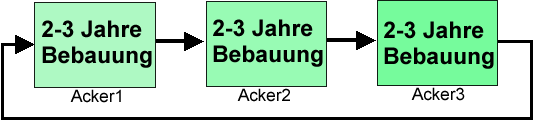 |
| Abbildung 1 : Urwechselwirtschaft, zum Erhalt der Erträge wandert der Bauer mit der Bestellung der Felder alle 2-3 Jahre zum nächsten Feld und läßt die anderen für diesen Zeitraum brach liegen. |
Eine weitere Methode zur Ertragssteigerung ist der Wechsel der Anbaufrüchte von Jahr zu Jahr. Da die Früchte unterschiedliche Nährstoffe aus unterschiedlichen Wurzeltiefen beziehen wird der Boden beim Wechsel der Anbaufrüchte besser genutzt und weniger belastet. Zu beachten ist allerdings die Reihenfolge des Anbaus. Nicht alle Pflanzen sind untereinander verträglich und haben unterschiedliche Wurzeltiefen und einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Nach einer Liste von G.Könnecke gibt es günstige wie ungünstige Früchteabfolgen. Günstig wäre hiernach z.B. Hafer als Vorfrucht und Roggen als Nachfrucht.
Aus diesen Erkenntnissen heraus entwickelte sich die Dreifelderwirtschaft. Mehrere Landwirte bewirtschaften eigenen Parzellen, welche zu einem großen gemeinsamen Acker gehören. Zwangsläufig bauen die Landwirte zur gleichen Zeit, die gleichen Produkte an. Typisch für die Dreifelderwirtschaft ist es, daß ein Feld brach liegen bleibt, die sogenannte Schwarzbrache. Durch den Früchtewechsel auf den Feldern konnte später auf diese Schwarzbrache verzichtet werden und es kam zur sogenannten verbesserten Dreifelderwirtschaft.
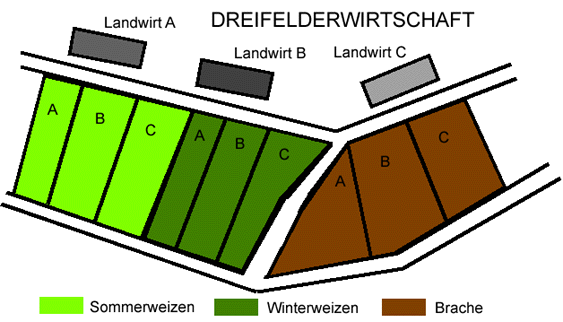 |
| Abbildung 2 : Dreifelderwirtschaft, die Bauern bewirtschaften die Flächen zur gleichen Zeit auf die gleiche Art. Im Falle einer verbesserten Dreifelderwirtschaft würde die Brache entfallen und ein Früchtewechsel auf den Feldern eingeführt. |
Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen wurde der Bedarf an Getreide immer größer. Die Bauern gaben zur Ertragssteigerung Mergel auf ihre Böden. Abgelöst wurde diese Methode von der Mineraldüngung. Diese Methode war ein Ergebnis der Forschung von Justus Freiherr von Liebig (1803-1873), welcher die Forschung der physiologischen Chemie revolutionierte. Der Professor für Chemie an der Universität München experimentierte erfolgreich mit chemischen Düngemitteln und führte Analysemethoden ein und erklärte den Gärungsprozess. Zu diesem Zeitpunkt war die Landwirtschaft am Ende ihrer Ertragsteigerung angelangt. Der Einsatz von mehr Arbeit und Kapital könnte keine Ertragssteigerung mehr erwirken, da die Kapazität des Bodens erschöpft ist (Ertragsgesetz).
Um die Dreifelderwirtschaft in einem Modell darzustellen entwarf Emil Meynen um 1950 das Anbaurad.
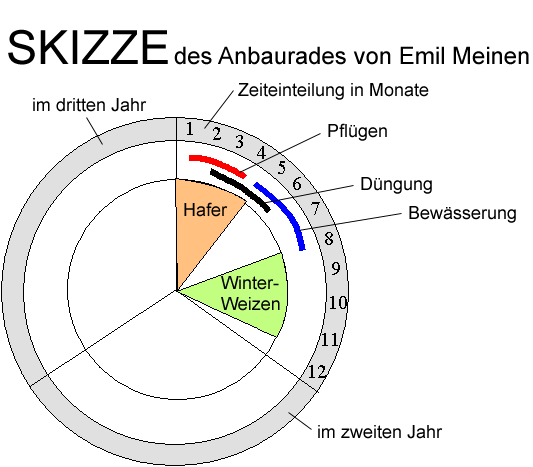 |
| Abbildung 3 : Skizze des Anbaurades von Emil Meynen. Das Anbaurad beschreibt lediglich die Abfolge der Nutzung einer Parzelle für den Zeitraum von 3 Jahren. |
Für die räumliche Betrachtung der Landwirtschaft ist es nötig, nicht nur eine Beschreibung von Abfolgen vorzunehmen, sondern vergleichbare Größen zu schaffen. So kam es bezüglich der Viehhaltung z.B. zu sogenannten Großvieheinheiten, den GV. Als Basis für die GV wird das Gewicht der Tiere genommen. Index für die Berechnung ist ein Rind, welches älter als 2 Jahre ist. Es bekommt dann die Maßzahl 1 GV. Die anderen Tiere werden an diesem Index bemessen :
Um eine Vergleichsgröße bezüglich der Getreideproduktion zu schaffen kam es zum Begriff des Getreideeinheitenschlüssels. Es handelt sich hierbei um den Energiewert des Getreides. Als Index wurde Gerste mit 1,0 belegt. Hafer hat dann einen Energiewert von 0,85.
Will man nun Getreide und Viehbestand miteinander vergleichen so nützen die Großvieheinheiten wenig. Zum Vergleich von Getreide und Vieh kam es zur Errechnung des Energiebedarfes von Viehbeständen. Eine mit dem Getreide vergleichbare Maßzahl der benötigten Energie wurde geschaffen. Rinder z.B. erhielten so die Maßzahl 5,9.